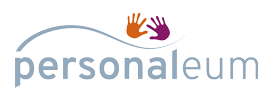Das gedachte Türschild lag nur wenige Minuten auf dem Tisch, bevor es zum roten Faden des Barcamps wurde:
„Nicht stören – ich lerne.“
Ein Satz, der banal klingt, aber eine ganze Lernkultur seziert. Niemand stellt sich ein solches Schild ins Büro oder hängt es an die Tür. Nicht nur, weil Lernen sich gar nicht so leicht vom Tun abkoppeln ließe, sondern viel mehr weil Lernen noch immer als unproduktive Unterbrechung gilt.
„Lernen ist für Menschen und Organisationen wichtig“ rufen wir einander kopfnickend zu, wird aber im Alltag – wenn überhaupt noch Zeit bleibt – erst erledigt, wenn die „echte Arbeit“ getan ist. Echte Erlaubnis im Arbeitsprozess fehlt, (Lern)Ziele kommen über nette Wunschvorstellungen nicht hinaus, und manche verhalten sich, als seien sie längst „ausgelernt“ – übrigens nach diesem Tag der dezidierte Unwort des Corporate Learning Camps diese Woche in Wien.
Mit dieser Energie und Offenheit starteten wir in 19 Sessions, die flugs am Sessiongrid klebten. Das Teilgeber:innen–Feld war bunt gemischt, aus allen Teilen Europas – entweder direkt angereist oder schon länger in und rund um Wien lebend. Die Location hat den Tag wunderbar getragen (DANKE an den Sponsor ÖPWZ, das uns das Trainingszentrum im Zentrum Wiens für diesen Tag zur Verfügung gestellt habt).
Mehr Intelligenz ins Lernen…
… das war unser Motto für dieses Barcamp. Und da durfte das Thema „Künstliche Intelligenz“ nicht fehlen. Aber es war allen klar, dass KI ohne die anderen (menschlichen) Intelligenzen nur ein stumpfes Werkzeug ist. Niemand sprach über Tools, Prompt-Baukästen oder Abkürzungen. Stattdessen über etwas viel Fundamentaleres, nämlich den Dreiklang „Können, Wollen, Dürfen“.
Kann ein Team überhaupt beurteilen, wann KI präzise oder gefährlich halluzinierend arbeitet? Wollen Menschen KI nutzen, wenn sie gleichzeitig Angst haben, bewertet oder ersetzt zu werden? Dürfen Teams experimentieren oder wird jeder Fehler sofort sanktioniert?
KI wurde damit zum Spiegel organisationaler Reife – nicht zum Technikthema. Und je länger wir sprachen, desto klarer wurde: KI scheitert nicht an fehlenden Skills, sondern an unpassender Lernkultur.
Wissen ist kein Assest, es ist ein Netzwerk
Damit rückten Governance, Entscheidungslogiken und Konfliktfähigkeit ins Zentrum. Strukturen, die Entscheidungen verzögern oder Verantwortlichkeiten zerfasern, verhindern mehr Lernen als jede Tool-Lücke. Und psychologische Sicherheit ist keine Nettigkeit, sondern die Grundbedingung für jede Lernbewegung. Wer „Ich weiß es nicht“ nicht sagen darf, wird auch mit KI nichts anfangen können – außer sie zu verstecken.
Spannend war, wie stark der Tag zeigte, dass Lernen dort entsteht, wo Menschen in Kontakt kommen – nicht dort, wo Prozesse sauber designt sind. Die Sessions zu Crowd Thinking, zu Expert Debriefing, zu Schulterblicken und zu „Nutzen, was da ist“ erzählten alle dieselbe Geschichte: Wissen ist kein Asset, es ist ein Netzwerk. Es wird aktiviert, wenn Berührungspunkte geschaffen werden – nicht, wenn Wissen abgefragt wird.
Lernen ist nicht Konsum, sondern Produktion
Das zeigte sich auch in den Formaten: Während im einen Raum über VR-Future Skills gesprochen wurde, zeigte ein anderer, wie mächtig Stift und Papier sein können. Schreiben ordnet Gedanken, Lesen hilft weiter, wenn Zuhören schwerfällt. Und im Obergeschoss entstand nebenbei ein spontanes Podcast-Studio, als unübersehbares Signal: Lernen wird nicht konsumiert – Lernen wird produziert.
Die Session zu Karrierewechseln erzählte dasselbe Prinzip auf persönlicher Ebene. Kompetenzen wachsen nicht entlang der Jobtitel, sondern an den Brüchen dazwischen. Transferfähigkeiten erkennt man nicht im Lebenslauf, sondern am realen Problem, das jemand lösen kann. Nebenbei landete das Thema Ageism auf dem Tisch — die Frage, ab wann jemand angeblich „zu alt“ ist. Die Antwort: nie. Die Realität: naja, komplizierter.
Wieviel Anreiz braucht Lernen?
Aus einem kurzen Pausengespräch zwischen Connie und mir entstand eine spontane Session „Braucht Lernen extrinsische Motivation, damit es gelingt?“. Connie argumentierte, dass Neugier und Wissensdurst erst durch extrinsische Impulse entstehen. Meine Gegenthese: extrinsische Motivation erstickt intrinsische Motivation – und hält nur solange die Dosis immer höher gehalten wird. Es ist wie bei Koffein: kurzfristig wirksam, aber kurzer Haltbarkeitszeitraum – und am Ende gar schädlich und wirkungslos.
Am Ende dieser guten Diskussion stand die Erkenntnis: Zuerst sollten wir Begriffe klären und dann erst diskutieren und abwägen. Und als Versuch einer Antwort auf die Frage: ein externer Funke kann schon helfen, Lernfreue zu initiieren — aber (dauerhaft) brennen muss es innen. Und die Organisation sollte dieses Brennen schützen und nicht ersticken.
Damit war die Brücke zurück zum Türschild geschlossen.
Modelle sind gut, aber kein Selbstzweck
Vor diesem Hintergrund bekam AVERA, das Admonter Veränderungsmodell, eine besondere Bedeutung. Nicht als Heilsversprechen, sondern als Orientierung. Das Modell wurde über die letzten drei Jahre in der Corporate Learning Community Österreich erarbeitet und weiterentwickelt und bieten einen hilfreichen Rahmen für die Begleitung von Veränderungs- bzw. Lernprozessen in Organisationen. Es hat nicht den Anspruch, Komplexität zu zähmen – sondern Wechselwirkungen, v.a. zwischen Management und Corporate Learning sichtbar und gestaltbar zu machen. Die passende Erinnerung aus der Nugget-Wand: Ein Modell ist kein Selbstzweck.
Lernen tun wir sowieso – aber nicht immer das, was wir (andere) wollen.
In der Abschlussrunde ergab sich aus meiner Sicht eine klare Zusammenfassung dieses vielfältigen Tages, der wie im Flug vergangen ist:
Lernen funktioniert besonders dann gut, wenn Organisationen Orientierung bieten (Future Skills), Geschichten erzählen (Story matters!), Räume öffnen (Lernzeit) und dabei nicht überdidaktisieren (Ein Modell ist kein Selbstzweck) – und wenn sie akzeptieren, dass Lernen die meiste Zeit leise und kaum bemerkt passiert.
Lernen ist immer eine ex-post-Beschreibung.
Oder einfacher: Lernen ist nicht das, was wir planen. Lernen ist das, was trotzdem passiert.
DANKE an alle Teilgeber:innen – ich freue mich schon aufs nächste Mal!